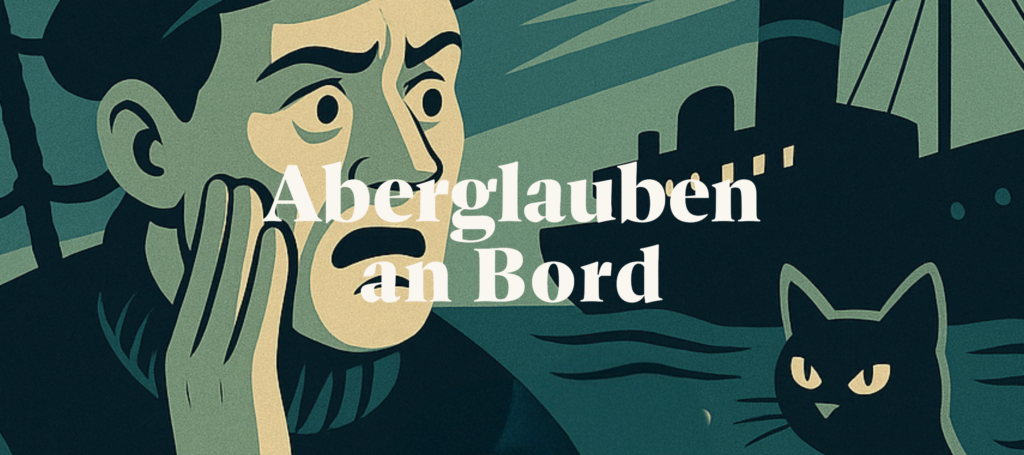Wenn der Aberglaube mitfährt. In den 1930er Jahren befand sich die Seefahrt in einer Übergangsphase zwischen traditioneller und moderner Technik. Schiffe waren zunehmend mit Dampfantrieb und Funkgeräten ausgestattet und Kapitäne konnten Wetterberichte nutzen, die das Risiko auf See verringerten. Trotz dieser Fortschritte spielte Aberglaube weiterhin eine bedeutende Rolle im Alltag der Seeleute. Besonders unter einfachen Matrosen hatten traditionelle Vorstellungen und Rituale eine psychologische Funktion, da sie halfen, die Unberechenbarkeit des Meeres zu bewältigen und das Gemeinschaftsgefühl an Bord zu stärken.
Ein weit verbreiteter Aberglaube war die Unglücksassoziation mit Freitag. Es galt als riskant, an diesem Tag auszulaufen. Frauen an Bord wurden ebenfalls noch skeptisch betrachtet. Viele Seeleute glaubten, dass ihre Anwesenheit das Schiff gefährden könne, wobei Ausnahmen nur in besonderen Situationen erlaubt wurden. Pfeifen war an Bord tabu, da man glaubte, dass das Pfeifen den Wind heraufbeschwören und Stürme verursachen könne. Ebenso galt das Umbenennen eines Schiffes als äußerst gefährlich, da dies die Schutzgeister oder das Schicksal des Schiffes erzürnen könnte. Wurde ein Schiff dennoch umbenannt, musste dies durch eine spezielle Zeremonie, häufig mit einer symbolischen Opfergabe an den Meeresgott Neptun, begleitet werden.
Tiere spielten eine wichtige Rolle als Glücksbringer und als Vorzeichen für Wetter und Sicherheit. Katzen galten als besonders nützlich, da sie Mäuse und Ratten fernhielten und gleichzeitig Glück symbolisierten. Das Verhalten von Möwen, Delphinen oder anderen Tieren wurde aufmerksam beobachtet, da Veränderungen als Vorhersage für Stürme oder andere Gefahren interpretiert wurden. Ratten, die das Schiff verließen, galten hingegen als schlechtes Omen.
Auch bestimmte Rituale waren weit verbreitet. Die Neptunfeste bei Äquatorüberquerungen wurden noch aufwendiger zelebriert. Dabei wurden die Matrosen getauft, um den Gott des Meeres gnädig zu stimmen. Vor dem Auslaufen wurden häufig Trinksprüche und Segenswünsche ausgesprochen, und Tabuworte wie „tot“ oder „Unglück“ durften an Bord nicht laut ausgesprochen werden. Galionsfiguren, oft in Form einer Frau, symbolisierten Schutz und Glück und wurden besonders sorgfältig gepflegt.
Insgesamt zeigt sich, dass Aberglaube auf Schiffen der 1930er Jahre ein integraler Bestandteil der maritimen Kultur war. Trotz der zunehmenden technischen Sicherheit und der verbesserten Wettervorhersagen hielt man an alten Traditionen fest. Sie dienten nicht nur dem Schutz vor Unglück, sondern stärkten auch den Zusammenhalt der Crew und halfen den Seeleuten, die Gefahren des Meeres zu bewältigen. Hier ein Überblick:
Zusammenfassung und Beispiele von Aberglauben und Bräuche an Bord:
- Frauen an Bord: Frauen galten auf Handelsschiffen noch oft als Unglücksbringer. Gleichzeitig glaubte man, dass eine nackte Frau am Bug (z. B. Galionsfigur) den Zorn des Meeres besänftigen könne.
- Wettervorzeichen: Bestimmte Himmelsfarben bei Sonnenauf- oder -untergang galten als Zeichen für gutes oder schlechtes Wetter. Sprüche wie „Abendrot – Gutwetterbot’“ oder ihr maritimer englischer Zwilling waren auch deutschen Seeleuten bekannt.
- Donnerstagsabfahrten: In manchen Regionen galt es als schlechtes Omen, an einem Freitag oder Donnerstag auszulaufen.
- Pfeifen an Bord: Das Pfeifen war an Bord häufig verboten, da es „den Wind herbeirufen“ sollte – manchmal mehr, als erwünscht.
- Tiere: Katzen galten als Glücksbringer, weil sie Mäuse und Ratten fernhielten, und ihre Bewegungen wurden als Wetteranzeiger gedeutet. Ratten, die ein Schiff verließen, kündigten angeblich Untergang oder Unglück an.
- Namensgebung: Das Umbenennen eines Schiffes galt als besonders gefährlich, weil man damit die Schutzgeister oder das „Schicksal“ des Schiffes herausforderte.